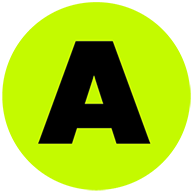Die Kunst, sich zu Irren
Die Kunst, sich zu Irren
Eine neue Woche mit spannenden Lernmomenten und Events geht langsam zu Ende. Ich sitze im Zug nach Berlin, an Erfurt und Halle vorbei.. “Just for your information, I am on ze’ train“, steigt der nächste Experte im Projekt-Call ein und klärt mit deutsch-englischem Akzent und holpriger Verbindung überzeugend, “wo es lang geht“. Mir gegenüber liest ein junger Student “Atomic Habits“, während andere Fahrgäste Podcasts hören oder sich durch soziale Medien scrollen – getrieben von der Idee, mit Daten jede Lücke in der Welterklärung zu stopfen.
Plötzlich sitzt mir Goethe auf der Schulter und spiegelt mir seinen literarischen Vorfahrer Wagner. “Zwar weiß ich viel, doch möcht’ ich alles wissen“, ruft Wagner in Faust I voller Inbrunst. 200 Jahre später hallt dieser Satz durch die Flure der Gegenwart – nur dass die Regale heute in Serverfarmen stehen, die Kataloge aus Metadaten und Emojis bestehen und die Studienpläne “Learning Pathways“ heißen.
Was aber, wenn die Sehnsucht nach Totalwissen – einst Triebfeder klassischer Gelehrsamkeit – heute vor allem eine List ist, die uns vom Wesentlichen ablenkt?
Wagner – der methodische Bibliomane
Goethes Wagner ist kein Bösewicht. Er ist fleißig, höflich, fast liebenswert in seiner systematischen Naivität. Man sieht ihn förmlich, wie er Karteikästen beschriftet und die Gläser seiner Brille blitzblank poliert – der letzte Mohikaner der altdeutschen Zettelkästen. Sein Vertrauen ist unerschütterlich: Wer nur lange genug Daten sammelt, findet am Ende den verborgenen Code des Universums.
Heute lebt Wagner in Prompt-Tabellen und Literaturverwaltungs-Apps, schreibt Peer-Review-Artikel über Mikrophänomene, die kaum jemand liest, und trägt stolz das Abzeichen des Knowledge Workers. Dabei ignoriert er – wie einst im Drama – den Elefanten im Raum: Jedes Faktum, das er ins Regal einsortiert, ist nur ein Mosaiksteinchen, dem die Urform fehlt. Sein Wissensdurst gleicht einer Inventarliste. Tiefgang? Nein, danke. Hauptsache, die Daten sind gefüllt.
Faust – der verwegene Sinn-Hacker
Faust sieht die leeren Regale seiner Seele. Der Professor hat alles studiert, was die frühneuzeitliche Alma Mater hergibt, und findet doch keinen Halt. Seine nächtliche Klage ist Schmerz, keine Koketterie: “Da steh’ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.“ Hier beginnt die Bewegung von der Bibliothek in die Erfahrungswelt – vom akademischen Kontoauszug zur gelebten Bilanz.
Im 21. Jahrhundert begegnen wir Faust in Menschen, die Hörsäle und Hackathons verlassen, weil Slides ihnen nicht mehr reichen. Sie suchen Dopamin in Extremsportarten, Spiritualität in Ayahuasca-Zeremonien oder bauen Start-ups, die “die Welt im Innersten“ neu verdrahten wollen – und riskieren dabei Konto, Beziehungen oder Ruf. Faust ist nicht moralisch überlegen; er ist nur radikaler. Erkenntnis ist für ihn leibhaftig. Bücher führen ihn an die Klippe, aber den Sprung muss er selbst wagen.
Ein gemeinsames Dilemma zweier Archetypen
Je digitaler unsere Lebenswelt, desto verführerischer wird Wagners Optimismus: Big Data, Generative AI, Precision Medicine – alles Versprechen, dass genügend Bits den Sinn schon stiften. Das Accelerationism-Narrativ aus dem Silicon Valley dient als neue Religion. Doch wir verwechseln Abrufbarkeit mit Begreifen. Wir messen Schlafzyklen, Schrittzahlen, Herzratenvariabilität – doch was bedeutet das für die Kunst zu leben, für unsere Lebendigkeit?
Charles Taylor nennt das unsere ‘Bedürftigkeit nach Bedeutung’. Wagner schichtet Regale höher, Faust reißt sie ein und sucht Licht zwischen den Splittern.
Goethe malt kein Schwarz-Weiß. Wagner schenkt Fußnoten, Archive, Verlässlichkeit – das Fundament der Zivilisation. Faust entfacht Inspiration, Wissenschaftssprünge, Literatur, die uns den Schlaf raubt. Diese Spannung zwischen Ordnung und Überschreitung hat mich einst zu “Possibilismus” inspiriert – ein Weg, wie wir Wissen und Möglichkeit in eine lebendige Zukunft führen könnten.
Zu viel des einen droht zur Überdosis zu werden. Zu viel Wagner, und die Welt erstarrt in Datensätzen, die Leben simulieren, aber nicht erfassen. Zu viel Faust, und die Welt verglüht im Sturm der Selbstüberschreitung. Wir opfern Integrität für Rausch und ruinieren, was wir lieben. In dieser Spannung lebt jede Institution, jede Tech-Firma, jede Familie.
Wagner lehrt Fleiß und Disziplin. Jeder Podcast, jedes Whitepaper, jede Studie – die Inhalte unserer algorithmischen Welt müssen kuratiert werden, bevor wir sie konsumieren. Was bringt deine Frage wirklich voran? Wie gelangst du mittels First-Principles Thinking zu tieferem Einblick? Faust erinnert daran, dass Erkenntnis oft erst nach der Schramme entsteht. Scheitern, Liebeskummer, Grenzerfahrung – Bibliotheken eigener Art. Bevor wir erklären, müssen wir erleben.
In einer Welt kostenloser Allwissenheit brauchen wir bessere Fragen, nicht nur Antworten. Wer mit Wissen spielt, sollte seine Annahmen kennen – in Demut, weil wir zu immer besseren Erklärungen fähig sind.
Ausklang im Deutsche-Bahn-Lernstübchen
Wagen 232. Der Projekt-Experte streamt inzwischen Squid Game, der Student hat Atomic Habits zur Seite gelegt – nicht, weil er satt ist, sondern weil er ahnt, dass eine Pause, vielleicht sogar ein Gespräch, mehr Erkenntnis bringen könnte als die nächste Seite.
Am Ende geht es nicht darum, Wagner oder Faust zu sein. Die Kunst besteht darin, den Wagner in uns zu mäßigen und den Faust zu zähmen: Fakten zu lieben, ohne im Archiv zu verschimmeln; Grenzen zu sprengen, ohne im Chaos zu verglühen. Goethes Dialog ist Einladung, kein Urteil.
So sitze ich da, als professioneller Amateur, halb Faktenheld, halb Seelensucher, und nehme wahr, dass der Zug zwar langsam rollt, die Geschwindigkeit der Technologie – von Simulationshypothese über technologische Singularität bis zu AHI (Artificial Human Intelligence) – jedoch unaufhörlich explodiert.
Ich flüstere: “Zwar weiß ich wenig, doch will ich fühlen.“ Und romantisiere den Menschen von morgen – einen, der nicht die Kunst, Recht zu haben, perfektioniert, sondern die Kunst, sich zu irren – und es wahrzunehmen.